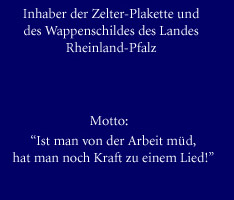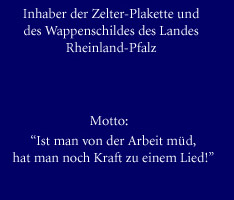Die Festrede
Gehalten zum 125jährigen Jubiläum des
Männer-Quartetts 1879 Mainz-Hechtsheim e.V.
anläßlich der akademischen Feier im Bürgerhaus Mainz-Hechtsheim
am 7. Mai 2004
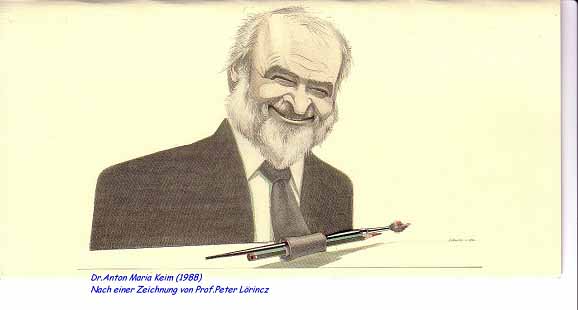
Dr. Anton Maria Keim
Kulturdezernent der Stadt Mainz a.D.
Es ist für mich eine Ehre und Freude, zum 125. Jubiläum
diese Festrede halten zu dürfen. Auch ohne Amt, aber aus engen
persönlichen und traditionell familiären Bindungen an
das Männer-Quartett tue ich dies gerne.
1954 zum 75. Vereinsjubiläum wurde ich unter Nr. 8 im Ehrenausschuss
genannt, Nr. 7 war mein Freund und damaliger Chorleiter, der unvergessliche
Hans Hilsdorf. Unter den zahlreichen Keims - es "keimt"
ja bis heute in dieser Sängergemeinschaft, und ich hoffe, der
Verein bleibt nie "keimfrei" - war u.a. auch mein Vater,
der Schuhmachermeister Jakob Valentin Keim aus der Strickergasse.
Dort ist ja das alljährliche, sympathische Brunnenfest der
Sängerfamilie und ihrer Freunde, für mich stets ein Erinnerungstreffen
an meine glückliche Kindheit im Schatten der alten Ulme und
der Kirche, deren Glocken meinen Tageslauf einläuteten.
1954 berichtete ich in der AZ in einem recht umfangreichen Artikel
zum 75. Jubiläum: "Tausend Sänger sangen ein Lied
der Freundschaft" in der über-füllten Großen
Turnhalle. Die Gemeinde Hechtsheim hatte ihr Festkleid angelegt
- mit Fahnen, Girlanden, einem Triumphbogen, in der alten Mundart
"Dorschmarscheer" genannt.
1979 war ich als Festredner ausersehen, allerdings mit dem Amtsbonus
eines Bürgermeisters und Kulturdezernenten unserer Stadt Mainz.
Mein Grußwort und meine Festansprache standen im Zeichen der
Gesang- und Musikkultur in Mainz und besonders der Hechtsheimer
Stadtteilkultur, die mir mit Büchereien und Vereinen stets
besonders am Herzen lag.
Heute - als Rentner, aber doch mit Würde - darf ich das Persönliche
stärker betonen, das Ortsgebundene, das Dorfverbundene. Zumal
es doch eine Familienanekdote gibt, die mir von Großeltern,
Eltern und Althexemern immer mal wieder aufgetischt wurde: Als das
Männer-Quartett im Juni 1929 sein 50. Jubelfest feierte, an
einem Sonntag, dem 16. Juni 1929, und Punkt ein Uhr mittags eine
- so angekündigte - "Massenkundgebung" des hessischen
Sängerbundes auf dem Lindenplatz begann, und sich anschließend
ein bunter Festzug aller mitfeiernden Vereine durch die Dorfgassen
zog, habe mein Großvater Philipp Kettenbach, Mitgründer
und aktiver Sänger - 1. Bass - mich kaum einjährigen Knirps
auf die Schulter gehoben und in offenbar leichter Weinlaune meinen
Eltern und der umgebenden Verwandtschaft zugerufen:
"Guckt emol, des is de kleinste Rappelkopp!"
Ich war dabei - wenn auch ohne Erinnerung.
Mitgründer, Ehrenvorstandsmitglied, bis ans Lebensende singender
1. Bass Philipp Kettenbach steht am Anfang der familiären Tradition.
Und manche auch aus der Keim-Sippe kamen dazu - bis heute. Kettenbachs
Leidenschaft war der Chorgesang, das Lied in der Gesellschaft und
Geselligkeit, - sein "zweiter Wohnsitz" war daher auch
die Sängerhalle.
Diese Gründer des Männer-Quartetts waren beileibe keine
spießigen Vereins-meier, die den Gesang von Wein und Weib
zum kräftigen Schoppen vorschoben. Sie waren im besten Sinne
politische Menschen, die dem Dorf und seiner Gesellschaft und Gemeinschaft
ein Feld kultureller Selbstdarstellung und Bestätigung anboten.
Und aus der engsten Gründergruppe kamen auch die Gründer
der örtlichen sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Und einige
von ihnen standen nach dem Bismarckschen Sozialistengesetz im Dalberger
Hof beim "Geheimbündeleiprozess" vor Gericht. Und
wurden verurteilt und fanden in Butzbach durch gleichgesinnte Aufseher
eine Art zweiten Bildungsweg. Anderhub war dabei. Kettenbach ging
wegen Berufsverbots nach Prag, wo Sozialisten und Juden ihm Arbeit
gaben. Der Gürtler Kettenbach konnte in der Wenzelskapelle
des Veitsdomes auf dem Hradschin den großen Gaskandelaber
installieren, - er
war - wie seine Freunde immer wieder ironisch witzelten - eben "Sozialist
und schwindelfrei".
Es ließe sich aus diesem festlichen Anlass viel Kulturpolitisches,
auch Gesellschaftspolitisches - und ganz Aktuelles sagen. Gerade
weil trotz aller positiven Erscheinungen, welche die Statistiken
offenbaren, im Vergleich mit Spiel und Sport im Freizeitsektor Musik,
Gesang, ja allgemein Kultur hierzulande noch immer eine recht untergeordnete
Rolle spielen. Roman Herzog hat dies festgestellt und bedauert und
betont:
Wer singt oder ein Instrument spielt, erlernt eine zweite Sprache.
Er erwirbt einen Lebensrhythmus, der ihm hilft, die eigene Persönlichkeit
zu entfalten. Und weiter: Musik- und Gesangvereine seien Treffpunkte
für Menschen, die eben nicht nur vor dem Fernseher hocken und
dem Verblödungsmechanismus erliegen.
Es lässt sich bei einem solchen festlichen Anlass, der Rückblicke
und zeitkritische Bemerkungen provoziert, manches über Singen
und Sänger sagen:
- dass Singen die Gesamtpersönlichkeit des Menschen beansprucht
und prägt,
- dass musizierende und singende Menschen ihre Freizeit kultivieren,
- dass dies Wege zur selbstbestimmten Freizeit sind - so ja auch
das Motto des Männer-Quartetts, das Arbeit und Freizeitsingen
ineinander setzt,
- dass Singen in Gemeinschaft ein Schutz vor Vereinsamung ist, weil
sich im Gleichklang des Liedes und der Stimmen Freunde finden.
Das Männer-Quartett ist ein Stück Ortsgeschichte - 125
Jahre einer Entwicklung vom Maurer- und Bauerndorf in der Bannmeile
der Reichsfestung über eine selbstbewusste Handwerker- und
Facharbeiterschaft zu einem explodierenden Stadtteil mit beliebter
Wohnlage - wenn die Düsenjets uns ab und an verschonen. Diese
Sängergemeinschaft ist eingewoben in die Dorfgeschichte. Sie
hat selbst als Kind der sogenannten Gründerjahre den Bismarckstaat
erlebt, der Liberale, Katholiken und Sozialisten unter Ausnahmerecht
mit Ausgrenzung stellte. Auch die Vereinsgründung war ein kultureller
und gesellschaftlicher Protest einer selbstbewußten Facharbeiterschaft
gegen das obrigkeitlich - nationale Misstrauen, das immer noch in
der Erinnerung an das aufbegehrende Bürgertum des Revolutionsjahres
1848 fortlebte. Bismarcks Sozialistengesetz - im Großherzogtum
Hessen-Darmstadt moderat vollzogen - ging ebenso wenig an diesem
Verein vorüber wie das nationalistische Großmaulgebaren
der wilhelminischen Zeit. Da hießen die Gesangvereine eher
"Germania", "Concordia" .......
Das Männer-Quartett verschrieb sich dem volksnahen Lied, dem
Volkslied.
Zwei Weltkriege forderten Blutzoll. Der Nazistaat forderte "Gleichschaltung"
und "Führerprinzip" im Vorstand. Und 1929 beim Jubelfest
war noch im Ehrenkomitee der "israelische Bürgermeister
Julius Weiß", der im KZ Maidanek ermordet wurde.
Nach jedem Krieg ging von den Konzerten und Theaterspielen Trost
und Hoffnung aus - und neue Pflege der Dorfgemeinschaft.
Der Schriftsteller Martin Walser, mit dem ich bis zu seiner umstrittenen
Rede in der Frankfurter Paulskirche befreundet war - was dem Rathaus
manche preiswerte Autorenlesung einbrachte - hat in seiner Autobiographie
gesagt: "In einem Dorf ist alles wichtig".
Und er meint damit: überschaubar, transparent in der kleinen
Gesellschaft.
Da entgeht nichts der Öffentlichkeit - und ein Gesangverein
ist ein dörflicher Mikrokosmos. Nichts bleibt verborgen: kein
Gespusi, kein Techtelmechtel, keine Schwangerschaft.
Das Kirchenjahr mit seinen Festen organisierte den Jahresablauf
auch mit öffentlichen Feiern - und die Sänger waren ein
Teil des Veranstaltungskalenders. Natürlich war die örtliche
Welt in Klassen eingeteilt. Das galt auch für die Soziologie
der Gesangvereine. Es gab reiche und arme, besitzende und "geringe"
Leut' ohne "Äcker, Geld und Sach", wie man sagte.
Da gab es die singenden "Bauern", die sich allmählich
öffneten, das sich abhebende neue "Männer-Quartett",
und dann die "Harmonie" und den "Vorwärts",
dessen Name programmatisch in eine sozialdemokratische Zukunft wies.
Die Vereinsschranken gingen bis in die Heiraten.
Selbst der Kirchenpatron Pankratius konnte die Klassengegensätze,
die Unterschiede nicht überwinden. Und wehe, einer von den
kleinen Leuten wagte es, einen feurigen Blick auf eine Bauerntochter
zu werfen. Auch beim Heiraten musste der Schuster bei seinen Leisten
bleiben.
In der Kirche freilich sangen alle - seit dem achtzehnten Jahrhundert
sogar in einem Kirchenchor. Aber unter dem wachsamen Auge des Klerus
war das ein anderes Liedgut als das der neuen Singvereine: Trinken,
Küssen und die heimliche Liebe hinterm Holderstrauch galt als
sündhaft und war als böse verpönt. Nun, die jungen
Sänger - lange vor den Sängerinnen - Singen im Verein
war lange Männersache - nahmen das augenzwinkernd zur Kenntnis
und die Alten verstanden es .... Schließlich drohte der inquisitorische
Beichtspiegel mindestens den mehrheitlichen Katholiken mit dem beginnen-den
Bekenntnis: " habe ich ----------".
Das Vereinsleben ist heute friedlich und harmonisch, auch weil
der Zugang der Jungen geringer geworden ist.
Mit dem Wirtschaftswunder nahmen die Kabarettisten die Gesangvereine
ironisch und spöttisch aufs Korn. Dabei sägten sie am
Aste der Gemeinschaft. Die Pflege der Radiosender vergaß allmählich
seit den Siebzigern den Chorgesangs. Lange waren Sendungen wie "Stunde
des Chorgesangs" und "Chöre der Heimat" beliebt
bei den Hörern und galten als Selbstdarstellung einer vielfältigen
Musiklandschaft. Das Ende ist bedauerlich.
Und als Mitte der siebziger Jahre Jockel Fuchs ein finanzielles
Förderprogramm für die Gesangvereine im Stadtbereich anregte
und bei passabler Finanzlage auch realisierte, gab es quer durch
die drei Fraktionen verständnislose Verwunderung. Dabei wollte
er nur klar machen: "Vereinspflege" - eine zwar freiwillige,
aber wichtige kommunale Aufgabe, endet nicht beim Sport.
Als ich kurz nach dem Ende des kommunistischen Jugoslawiens bei
einer großen Jubiläumsfeier in der Partnerstadt Zagreb
unsere Stadt vertreten durfte, lud der Stadtpräsident beim
festlichen Menü in der Oberstadt überraschend einen jungen
Chor ein und begrüßte ihn mit der Bemerkung, sie sängen
Lieder des kroatischen Volkes, die jahrzehntelang verboten waren.
Er meinte: wenn man den Menschen ihre Volkslieder nimmt, nimmt man
ihnen die Seele.
Kurz vor seinem Tod im Jahre 1987 schrieb mir der Komponist, den
die Nazis aus seinem Amt als Direktor des Mainzer Peter-Cornelius-Konservatoriums
in die Emigration jagten, Hans Gal, als ich ihm einen Mainzer Hochschulchor
als Botschaft der von ihm immer noch geliebten Stadt nach Edinburgh
schickte:
"Lieber, sehr geehrter Herr Bürgermeister,
soeben hatten wir einen sehr willkommenen, unbeschreiblich eindrucksvollen
Besuch Ihrer Mainzer jungen Studenten, die ganz prächtig gesungen
und mir eine große Freude bereitet haben.
.....Ich fand es rührend ...... Ich freute mich innigst darüber,
dass der Chorgesang immer noch auf der alten, technisch und musikalisch
mustergültigen Höhe steht.....".
Gesang als Botschaft,
Singen als Brückenschlag.
Robert Schumann:
Höre fleißig auf alle Volkslieder. Sie sind eine Fundgrube
der schönsten Melodien und öffnen dir den Blick in den
Charakter der verschiedenen Völker.
Man muss ja nicht übertreiben, wie mein Freund Prälat
Walter Seidel bei einer Predigt im Mainzer Dom für 50 Jahre
Sängerkreis Mainz, 1999, --- als er meinte:
Wer singt, kommt in den Himmel.
Ich denke, das hat nach dieser Jubelfeier noch geraume Zeit.
|